Kennen Sie noch die 7 Todsünden aus dem Religionsunterricht? Die sind noch immer hochaktuell. Und es gibt sie auch für die Customer Experience. In meinem Videocast fasse ich heute zum Jahresende zusammen, was auf Ihrer Website 2021 nicht (mehr) zu finden sein sollte.
Videocast
Der Vortrag entstand anlässlich der Swiss Online Marketing Konferenz im Oktober 2020.
Mitgeschrieben für Eilige
Wer lieber einen Text überfliegt statt zuzuschauen, findet hier die Mitschrift zum Vortrag mit Beispielen und Alternativen zu Bilder-Neid, Branding-Hochmut, Verkaufs-Wollust, Innovations-Völlerei, Daten-Habgier, 3-Klick-Zorn und Erklärungs-Faulheit.
[In den Text klicken und danach „Play“ drücken, um das Vorgeplänkel zu überspringen und synchron mitzulesen.]
SOM_Zeix AG_Ramón Bill: Todsünden für die Customer Experience – powered by Happy Scribe
Ich erzähle euch jetzt die sieben grössten Todsünden, die ihr in der Customer Experience oder vor allem in der User Experience begehen könnt. Und ich zeige euch nachher auf einer Slide drei Tipps, wie ihr das vermeiden könnt. Lehnt euch also zurück.
Früher im Mittelalter war es so, da war die ganze Customer Experience noch eine sehr ethisch-moralische Angelegenheit. Also wehe, da hat man jemanden über den Tisch gezogen, dann kams so raus wie auf diesem Fresko, einem Wandbild, von Dantes Monumentalwerk. Das ist sein erster Gesang, wo er durch die Hölle geht. Und ihr seht hier – das ist das spannende – die Hölle wird hier als Trichter dargestellt. Und die Sünden werden ganz bürokratisch kategorisiert. Die einfacheren Sünden, die werden oben abgestraft – das ist nicht ganz so schlimm. Und je schlimmer die Sünde ist, je weiter runter kommt man [im Trichter]. Und ganz unten sind dann die ganz üblen Methoden und die ganz üblen Sünden vertreten. Und das heisst eigentlich nichts anderes als oben sind die, die einfach irgendwie schwach geworden sind und einer Versuchung nachgegeben haben und unten sind dann die, die wirklich böswillig etwas getan haben. Das ist der Unterschied.
Wenn wir zur katholischen Kirche wechseln, dann haben wir die „peccatum mortiferum“, das sind die Todsünden. Die Todsünden, die sind schlimmer als normale Sünden, weil die Todsünden jemand willentlich begeht und sich somit willentlich aus der Gemeinschaft mit Gott verabschiedet. Und ich möchte ja nicht, dass Ihr willentlich den Pfad der guten User Experience verlasst.
Heute leben wir in einer digitalen Welt. Es ist vielleicht ein bisschen weniger moralisch teilweise, aber vielleicht wäre es eben manchmal angebracht. Und deshalb erzähle ich euch die sieben Todsünden, die ihr digital begehen könnt. Und erkläre euch aber auch, wie ihr die vermeiden könnt.
Warum kann ich das? Warum bin ich hier quasi Moralapostel oder Hohepriester? Ohne uns gross vorzustellen, einfach kurz: wir sind eine Agentur für User-Centered Design. Und User-Centered Design beinhaltet ganz viele Tests. Das heisst, wir testen laufend Webapplikationen, Apps, aber auch Touchscreen Applikationen. Wir wissen darum ziemlich genau, was nervt, was funktioniert und was nicht. Weil wir über 4000 Personen in Usability Tests gesehen haben. Die sind nicht quantitativ, sondern ganz qualitativ. Und aus diesen Tests ziehe ich jetzt die sieben Todsünden raus.
1. Todsünde ist „Bilderneid“. Eines vorneweg, es geht hier nicht um schlechte Bilder. Schlechte Bilder sind auch eine Todsünde, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man gute Bilder wählt, dass man gute Fotografen bezahlt und dass man hier gute Bilder hat. Dann geht’s aber darum, wie setzt man die ein? Weil Bilder haben eine extrem grosse Wirkung. Und wenn man die Wirkung falsch einsetzt, dann kommt sowas raus. Ich habe oben jetzt mal abgedeckt, worum es geht.
[Beispiel Gletscherfoto] Ihr könnt euch selber mal überlegen: Wofür steht dieses Bild? Jetzt mal abgesehen davon, dass die Frage auf einer Homepage noch eine achte Todsünde wäre, aber das lassen wir mal weg: Was ist das? Eine Webseite für Polarexpeditionen? Eine Seite für irgendwie Skitouren buchen? Oder sonst ein Wintersportort oder sowas? Weit gefehlt! – Es ist eine Bank. Ein Beispiel, wie Bilder eine Wirkung erzielen, die – gerade im übertragenen Sinne – funktionieren mag, die aber kein User verstehen wird.
Ein weiteres Beispiel [Krankenkasse]: Nehmt mal an, Ihr seid Besitzer eines kleinen KMU. Und nehmen wir weiter an, dummerweise sind eure Daten von diesen bösen Leuten im Internet verschlüsselt worden und euer Backup ist nicht ganz up-to-date. Ihr habt glücklicherweise eine Versicherung abgeschlossen bei der Groupe Mutuel und kommt auf diese Seite, um nachzuschauen, wo kann ich hier die Schadensmeldung machen … und dann das? Die lachen euch aus!
Da ist ein Bild, das hier [auf der Startseite] drauf ist, wo ich relativ schnell den Überblick bekommen sollte und sehen sollte, wo es hingeht – genau da lachen mich Leute an. Und das mit dem „Leute anlachen“ kann ich euch sagen, das kommt häufig vor. Ein anderes Beispiel [einer Krankenkasse]: das mit dem Anlachen ist etwas, das wir in Tests wirklich häufig zurückgemeldet kriegen. Wir haben das nie als Punkt auf [dem Testkonzept], das wir das abfragen. Die Leute kommt von sich aus und nerven sich über dieses Lachen. Weil auch hier gilt: Vielleicht sind sie krank, sie brauchen eine Information und kommen hier auf die Website – und dann werden sie angelacht. Was eigentlich dann noch doppelt schlimm ist: sie [die Models] schauen in die falsche Richtung. Weil – wenn Ihr schon so ein Bild setzt, dann müssten sie eigentlich nach der Mitte schauen letztendlich.
[Zwischenfazit] Zusammengefasst: Hier kommen zwei Phasen der User Experience durcheinander oder der Customer Experience, wie sie klassisch ist. Zuerst geht es immer darum, Aufmerksamkeit zu generieren. Das schafft Ihr mit einem Plakat, einem Banner. Da sind emotionale Bilder super. – User auf der Website sind sehr häufig schon eine Stufe weiter. Da geht’s darum, erste Informationen zu gewinnen, einen Überblick zu bekommen. Es geht um „Consideration“. Da sind diese Bilder schlicht und einfach falsch. Sie lenken ab. Das Zweite sind Bilder, die überhaupt nicht zum Inhalt passen. Bilder sind Inhalt und müssen zum Text passen. Umgekehrt ist eigentlich auch gut.
Kommen wir zur zweiten Todsünde, zum „Branding Hochmut“. Branding ist sehr wichtig, auch für KMUs. Damit man wirklich weiss, wie man auftreten will und so weiter. Wie die Farben sind, dass man einheitlich daher kommt, dass man ein Mood Board hat – alles gut und recht. Aber [Beispiel Mobility] Ihr alle kennt mobility. Und ihr alle wisst: Mobility Autos sind rot. Jetzt habt ihr hier dieses Rot auf der Karte, ihr habt auch noch grau. Jetzt habt ihr einfach eine Schwierigkeit. Jeder Mensch hat gelernt: Rot heisst „rote Ampel“, heisst „Stop“, heisst „Vorsicht“, heisst „nichts mehr da“, heisst „vergeben“.
Hier heisst rot aber „wir haben noch ein freies mobility Auto“. Das führt jedes Mal zu einer Unsicherheit und zu einer Überlegung. Es ist jetzt komplett sinnlos, hier die Branding-Farbe zu verwenden. Ein Beispiel, das fast noch schlimmer ist – ihr ahnt es schon – das ist publibike. Ihr ahnt es schon: hier dürfte die Branding Farbe violett sein, das ist richtig. Da hat jemand gefunden, wir schreiben auch noch die Strassen in violett an, mit dem Effekt, dass der Haupteffekt der Karte, eine Übersicht zu kriegen, ins Nirwana verläuft, weil man das kaum lesen kann.
Was wir häufig sehen ist, dass wir vom Branding Vorgaben angeliefert kriegen. Da sind dann auch Farben drin, wie z.B. hier links [im Farbschema]. Dann weiss man eigentlich schon, das sind Print-Farben. Weil online braucht ihr viel mehr Farben. Jeder einzelne Button, alles hat verschiedene Farbschattierungen im Web: Ist es angewählt? Ist die Maus drüber? Es ändert sich die ganze Zeit. Plus – und das ist enorm wichtig, nehmt das bitte mit – Farben haben online auch Funktionen. Sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern sie haben Funktionen. Und deshalb hat dann hier bei dem Beispiel unsere Farbwelt faktisch so ausgesehen. Und Ihr seht – mit den Rot- und Blautönen – da sind ganz neue Farben drin, das sind die Auszeichnungsfarben.
Ein anderes Beispiel ist die Lesbarkeit der Schriften. Die Schriftgrösse ist im Web je nach Screen sowieso völlig anders. Dann gibt es häufig die Diskussion mit den Serifen – oder das Gegenteil – die grotesken Serifen sind die kleinen Häkchen, die es bei Garamond gibt. Im Print – sagt man – sei das sehr wichtig. Online spielt das keine Rolle, ob es Serifen hat oder nicht. Eine Rolle spielt die Höhe der Kleinbuchstaben, die x-Höhe. Ihr seht hier, bei Helvetica Roboto ist die Kleinhöhe höher. Deshalb sind die besser lesbar. Und jetzt gibt’s noch etwas Zweites, das entscheidend ist – neues Fremdwort – die „Punzen“. Das sind die Innenräume eines Buchstabens, die nicht gedruckt sind. Die können zu sein oder die können offen sein. Dann seht ihr eben hier den Nachteil der Helvetica. Da ist das „e“ fast zu. Wenn die Schrift klein wird, könnt ihr das kaum mehr lesen. Bei der Roboto ist das viel weiter geöffnet, da ist die Lesbarkeit sehr viel höher.
[Zwischenfazit] Am besten wäre eigentlich, ein webtaugliches Branding schon beim Briefing anzufordern. Und ansonsten ist wichtig, dass es im Web viel mehr Farben als im Print braucht. Und das nicht nur im Web, sondern bei allem, was digital ist. Und Farben übernehmen ganz klare Funktionen. Das ist extrem wichtig. Schriften, x-Höhe und die offenen Punzen sind wichtig.
Kommen wir zur dritten Todsünde, zur „Verkaufs-Wollust“. Schon fast ein banales Beispiel ist [im Online Shop für Parfüm] der Prospekt als Webseite umgesetzt. Da hat’s oben dann eine Navigation mit enorm vielen Auswahlmöglichkeiten, dann ein Visual mit sehr vielen Brands. Da weiss man nicht, kann man das jetzt klicken oder nicht? Dann gibts einen Slider, dann gibt’s unten noch mal sowas wie eine Navigation. Wenn wir weiter runter gehen würden, hätte es noch Teaser – da hat kein User eine Chance, irgendwas zu finden, der ist gleich wieder weg.
Ein anderes Beispiel ist der Verkaufsprozess. Links seht ihr es ein bisschen grösser [im Online Shop für Blumen]. Da hat man sich – nett ausgewählt für einen doch amtlichen Preis – einen grossen schönen Blumenstrauss. Man hat auch gesagt, wann man den will. Und dann möchte man den bezahlen. Und jetzt seht ihr auf der rechten Seite, über wie viele Upselling-Möglichkeiten ihr jetzt hinwegscrollen müsst, bis ihr irgendwann ganz unten die Bezahlmöglichkeiten findet.
Auch schwierig ist das Beispiel hier [Online Shop für Wein]. Ihr seht hier einen Preis – ganz Behavioral Economics – der ist günstiger als der durchgestrichene Preis. Das signalisiert günstig. Aber unten steht dann beim Einkaufswagen die Sechs. Ja, sind das jetzt sechs Flaschen? Und die kosten 48 Franken oder wie ist jetzt das? Wenn ihr weiter klickt, seht ihr nein, die Einzelflasche kostet 48 Franken. Aber warum schreibt man dann unten 6 hin? Und warum schreibt man unten nicht den Preis von sechs Flaschen hin?
Jetzt kommt ein Beispiel, das ich gestern noch gemacht habe. Passend zum Vortragsthema habe ich ein Buch bestellen wollen bei Amazon „Die 7 Todsünden“. Und ihr wisst bei Amazon, wenn ihr es ein bisschen braucht – rechts unten, der gelbe Balken heisst, ich kann weiter. Klick gelber Balken, Klick gelber Balken … Mist. Jetzt habt ihr schon etwas gekauft, was ihr nicht haben wollt. Weil damit habt ihr jetzt ein Amazon Prime Abo abgeschlossen. Das ist zwar gratis zu Beginn, das ihr aber aktiv kündigen müsst, weil sonst habt ihrs und dann kostet es. Ihr müsst…. hier weitergehen. Das heisst im Fachjargon „Dark patterns“. Hier nutzt man Usability Faktoren, um die Leute zu Klicks zu verleiten, die sie eigentlich gar nicht machen wollen.
Hierzu muss man zur Verkaufs Wollust sagen: wenn ihr loyale Kunden wollt, dann müsst ihr eine gute User Experience bieten. Sonst sind die Leute nicht mehr da. Und bezüglich der Dark Patterns – ja, wenn man Amazon ist, ist man sehr wahrscheinlich so gross, dass man sich relativ viel leisten kann. Aber was wir in den Usability-Tests immer wieder sehen: die Leute nervt’s und zwar ziemlich deutlich. Und es gibt bei fast allem andere Anbieter, das heisst, ihr verliert die Kunden, und zwar die loyalen Kunden.
Gehen wir weiter zur „Innovations-Völlerei“. Ich habe hier ein Video gemacht von einem Beispiel mit einem schönen Inhalt: 50 Jahre Schweizer Musikhitparade. Sie würde in echt noch tönen. In den Unterlagen habt Ihr die Website. Ihr könnt hier suchen: Was war euer Geburtsjahr? Was waren die 10 Jahres-Besten in diesem Jahr? Spannend, alles ist vertont …. das Problem wird einfach sein, wenn ihrs einmal per Zufall gefunden habt, Ihr werdet es nie mehr wieder finden. Weil die Navigation hier so schwierig ist. Ich hab dann bei „El Condor pasa“ aufgegeben.
Ein anderes Beispiel: alles was man digitalisiert ist doch super, oder? Ich finde ja Digitalisierung auch cool. Aber dann hat man angefangen, hier bei der Autosteuerung zu digitalisieren. Und irgendwie hat man einfach vergessen, den Kontext der User mit einzubeziehen. Bedient mal einen solchen Touchscreen, wenn Ihr Auto fahrt. Ihr müsst ja laufend draufschauen. Ihr könnt das kaum bedienen. Da ist ehrlich gesagt die alte, sehr haptisch orientierte Bedienung schlicht und einfach überlegen. Also: nie den Kontext vergessen, in welchem das Ganze vom User genutzt wird und daran anpassen.
Ein sehr analoges, aber sehr klassisches Beispiel ist diese Liftsteuerung, die sehr wahrscheinlich schon manchen zur Verzweiflung getrieben hat. Eine Liftsteuerung, die ist entweder horizontal im Spital, da wo man mit dem Rollstuhl hinfahren kann oder sie ist vertikal und dann ist ganz oben der oberste Stock und ganz unten ist Erdgeschoss oder Keller. Aber so wie hier – das kann kein Mensch bedienen.
[Zwischenfazit] Innovation also bitte nicht als Selbstzweck, nicht auf Kosten der User Experience. Und wenn Ihr Vorgänge digitalisiert, stellt einfach sicher, dass Ihr Kontext, Schwierigkeiten und Bedürfnisse der User wirklich begriffen habt, bevor ihr einen digitalen Prozess daraus baut. Bedenkt, dass es „mentale Modelle“ Das heisst, es gibt Dinge, da ist allen eingeimpft und klar, wie das zu funktionieren hat. Das heisst nicht, dass man das nie ändern darf. Es heisst aber, dass man das nicht leichtfertig anders machen sollte, sondern sehr bewusst und sehr überlegt. Da muss man etwas bieten, das effektiv Vorteile hat. Sonst macht es wenig Sinn.
Jetzt haben wir [von meinen Vorrednern] von Facebook und von Video SEO gehört. Da ist natürlich viel von Daten die Rede. Daten sind ja das neue Gold und Daten sind super – das finde ich ja eigentlich auch. Es ist einfach so, dass mein Kunden-Alltag eher so aussieht: ich komme zu den Kunden und ich frage mal, wie läuft dann so die Site, wie entwickelt die sich und dann bekomme ich ganz viele bunte Grafiken zurück und einzelne Zahlen. Aber das Wissen rundherum, was diese Zahl, z.B. die Bounce Rate, wirklich misst, was eine Veränderung der Bounce Rate effektiv heisst, was man aus den Zahlen heraus gar nicht sagen kann, oder was in Kombination mit anderen Zahlen passiert und welche Zahlen man überhaupt anschauen soll – da herrscht sehr häufig grosses Unwissen. Und wenn man dann noch fragt, wie sollte sich das entwickeln, also die Frage nach einer Zielsetzung, dann wird es doppelt schwierig.
Ein anderes Datenbeispiel betrifft Daten, die man dann vom User sammelt. Analytics sind ja nur die Basis. Aber ich hab ein Beispiel rausgenommen, das ist eine App. Damit kann man Fahrradtouren planen, die App trackt, wo man durchfährt, die macht ein schönes Höhenprofil, die schreibt das alles auf – super Geschichte. Dann installiert man das Teil, öffnet es und der allererste Screen, den man nicht wegklicken kann, ist diese Datenabfrage. Ich muss mein Geburtsjahr, meine Grösse, mein Gewicht, mein Geschlecht angeben. Es ist immerhin angeschrieben, weshalb. Es gibt ein Zusatzfeature in dieser App, womit man auch die verbrauchten Kalorien berechnen kann. Aber ich kann die App gar nicht brauchen, wenn ich das nicht eingebe. Das macht nicht wirklich Sinn. Sehr viele Leute sind dann einfach weg.
[Zwischenfazit] Schaut, dass Ihr ein Monitoring habt, dass ihr eine regelmässige Auswertung macht und dass ihr euch einmal die Mühe macht, klare Zielgrössen festzulegen, sogenannte KRIs, Key Result Indicators. Und dann unterscheidet: Was ist notwendig, damit wir dir das und das bieten können? Und was ist optional – und verliert da bitte nicht die User-Perspektive aus den Augen. Und drittens, kommuniziert zumindest, wozu ihr was braucht und was ihr damit macht.
Lieblingsbeispiel für eine Todsünde, die ich in meinem Alltag häufig sehe, ist der „3-Klick-Zorn“. Man ist dabei, eine Website neu aufzustellen und dann kommt der Besitzer einer Applikation in diesem Unternehmen und sagt mit ziemlich grossem Furor: „Mein Inhalt muss in 3 Klicks erreichbar sein“. Warum? Das sei eine allgemeine Regel, wenn das nicht in 3 Klicks auffindbar ist, dann ist das quasi unsichtbar. Dann sei das weg – wisst Ihr, wozu das führt?
Das hier ist eine Beispiel-Seite [von der Bundesverwaltung]. Nehmen wir hier [in der Navigation] Klima, dann klappt die aus. So sieht das aus, wenn alles in 3 Klicks erreichbar ist. Wir haben das auch getestet. Wir haben Tiefeninterviews gemacht mit Laien, mit Spezialisten, mit Experten, die wissen, wie toll die Inhalte sind, die sich dahinter verbergen. Diese Inhalte sind wirklich gut; die User haben sie geschätzt. Sie mussten in unserem Usability-Test über diese Navigation versuchen, diese Inhalte – die sie ganz klar kennen, die sie häufig brauchen – zu finden. Sie wurden sauer, schon fast leicht ausfallend und haben abgelenkt. Sie hatten keine Chance hier etwas zu finden.
[Zwischenfazit] Verständlichkeit ist wirklich wichtig, weil die Leute entscheiden sehr schnell, wo es weitergehen soll. Dafür braucht es eine sehr durchdachte Informationsarchitektur und wirklich gute Begriffe. Was aber wirklich egal ist: wie viele Klicks dorthin führen. Und ich sags gerne noch mal deutlicher. Diese 3-Klick- Regel, die ist schlicht und einfach Blödsinn.
Kommen wir zur letzten Todsünde, zur Erklärung- Ignoranz. [Beispiel Elektronik Shop] Wir haben hier ein nettes kleines Schiffchen… oder sehr wahrscheinlich einen Einkaufskorb. Da fand jemand, wir machen das Icon ein bisschen anders. Das wird nicht verstanden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn ihr das testet, werden sehr viele Leute nicht rausfinden, wie sie jetzt zu ihrem Einkaufskorb kommen.
Ein anderes Beispiel hier [Website eines Restaurants], diese Website haben wir für Tests gebraucht. Da kann man zunächst die Frage stellen, wie viel weisse Schrift auf schwarzem Grund kann man lesen? Aber das ist ein Detail. Die User haben [im Test] nicht herausgefunden, wo hier das Menu [die Navigation] ist. Weil sie haben das umgedrehte Hamburger Icon oben schlicht und einfach als Dekoration wahrgenommen. Sie haben nicht mal probiert, da drauf zu klicken. Das war schlicht und einfach nicht klar.
Und das führt zum Hamburger-Symbol an sich: Jetzt beginnt dann wieder die Vorlesung für die neuen Informatiker an der BFH in Bern. Und die müssen [in der Übung] immer Lösungen in User-Centered Design machen. Da kommt dann fast bei jeder Gruppe irgendwann die Menü-Geschichte auf. Dann benutzen sie [dieses Menü Icon] und finden „Das versteht jeder“. Dann sage ich nein und in Tests sehen wir einfach, das versteht überhaupt nicht jeder! Und sie müssen dann selber auch Tests machen und nach dem Test schreiben alle Gruppen das Icon an, weil sie gemerkt haben, dass es wirklich nicht klar ist.
Sagen wir noch etwas zur Fehlertoleranz. Das ist auch ein Klassiker mit erklärenden Texten. Ich habe hier [im Formular] ein Datum eingegeben und unten sagt mir das Formular, ich solle bitte ein Datum eingeben. Warum sagt das Formular mir nicht, in welchem Format ich dieses Datum eingeben soll? Hier sollte man „1977“ schreiben. Oder warum ist es nicht so fehlertolerant, dass es auch dieses Datum lesen kann? Denn 1877 bin ich sicher nicht geboren.
Ein weiteres Beispiel für eine Benennung oder eine Begrifflichkeit sehen wir [bei dieser Autoversicherung]. Das ist eine Auto-Offerte, die man ausfüllen kann. Wir haben das auch getestet in einem Vergleichstest, da kam der „Drive Partner“ hinzu. Für die meisten Leute war es nicht so, dass sie das „i“ daneben drücken mussten. Da war völlig klar: ja, meine Tochter fährt häufig mit mir mit. Das nehm ich. – Die haben das genommen! Als sie die Offerte fertig ausgefüllt war, hiess es am Schluss: „Einbauen: Den Drive Partner können Sie einfach selbst einstecken und aktivieren.“ Da war ihnen dann klar, sie hatten das irgendwo nicht verstanden. Das liegt aber nicht an den Usern. Es liegt daran, dass der Begriff schlicht und einfach nicht funktioniert.
[Zwischenfazit] Bitte erklärt, was immer ihr könnt. Aber bleibt prägnant und schaut, dass ihr Begriffe braucht, bei denen man wirklich eine Chance hat, die zu verstehen. Schreibt am besten sämtliche Icons an. Es gibt ein paar wenige, die funktionieren, aber das sind weniger als ihr denkt. Ich würde vielleicht mal wagen auf vier oder fünf zu kommen, aber lassen wir das – ich würde alle anschreiben. Wann immer möglich schaut, dass ihr fehlertolerant seid, dass man ein Datum in allen möglichen Formen eingeben kann. Oder wenn nicht, dass zumindest eine Rückmeldung kommt, die dem User ermöglicht, etwas richtig einzugeben.
Ein beliebtes Beispiel hier sind auch immer Passwörter. Ich gebe ein Passwort ein und erst sagt es mir, ja bei uns musst du so viele Sonderzeichen, grosse Buchstaben und Zahlen brauchen. Wenn man mir das von Anfang an sagen würde, dann wüsste ich das und müsste keinen Fehler produzieren.
[Fazit] Was hilft das jetzt konkret? Gute Frage. Als „Take away“ möchte ich euch mitgeben: ihr wisst jetzt, was „Punzen“ sind, das ist wichtig fürs Mittagsgespräch :-). Das wird keiner wissen am Tisch … nichtdruckende Innenfläche eines Buchstabens…Spass beiseite.
Todsünden kann man vermeiden, indem man nachdenkt. Dafür sind drei Dinge wichtig. Das erste ist, man muss die eigenen User kennen. Ihr müsst wissen, wen ihr bei euch [im Kundenkreis] habt, wie die funktionieren, was die wollen, was deren Bedürfnisse sind, gerade auch online. Und dann würde ich vorschlagen, die zentrale Fragestellung ist immer, wie hilft das unseren Usern? So werden schon sehr viele Fehler vermieden. Oder um den Bogen zum Thema der Präsentation zu schlagen, zu den Todsünden – man kann es auch so sagen: Was du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Wenn ihr etwas von den Usern verlangt oder ihnen etwas unterjubelt, dass ihr selber eigentlich anstössig findet, dann macht’s doch bitte auch nicht.
Und wenn ihr mehr zur Optimierung der Customer Experience erfahren wollt, dann könnt ihr bei uns ein Webinar, ein UX Audit oder auch ein Webprodukt buchen. Ihr findet hier meine Kontaktdaten, unter denen ihr mich oder uns erreichen könnt. Damit gebe ich zurück zur Moderation, ich wäre durch und ich bin gerne da für weitere Fragen.




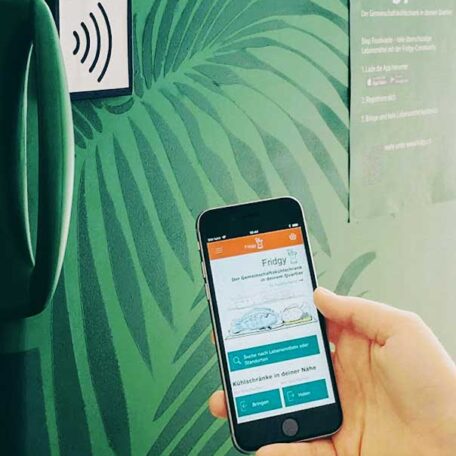


Kommentare